2. Projektskizze entwickeln & Rise360-Lizenz beantragen
Ihr habt eine Idee? Was es jetzt noch braucht und wie ihr zu einer Lizenz kommt, erfahrt ihr in den 7 Steps zum E-Training
Empfehlungen zur Planung & Produktion von E-Trainings
1. Welche Inhalte eignen sich besonders für ein E-Training?
Geeignet sind Inhalte, die...
- ...als Grundlage, Einführung, Ergänzung oder Vertiefung einzelner Themen eingesetzt werden können, um sie in Präsenz zu üben, zu diskutieren etc.
- ...sich in inhaltlich abgeschlossenen kurzen Lerneinheiten umsetzen lassen (z.B. 1 E-Training = 1 LE ODER 1 Thema in 3 E-Trainings = 3 LE)
- ...mehrfach nutzbar sind und nur einen geringen Aktualisierungsaufwand erfordern
- ...kursübergreifend einsetzbar sind (z.B. BB, VZ etc.), in verschiedenen Studiengängen oder übergreifend über alle Kompetenzfelder
- ...inhaltlich ident bleiben, um Versionierungen und damit Mehraufwand zu vermeiden
2. Ab wann lohnt es sich ein E-Training zu entwickeln?
Empfehlung der FHV zur Nutzbarkeit
- Je häufiger ein E-Training genutzt wird, desto ‚rentabler‘ ist das anfängliche Zeitinvestment
- Wenn Inhalte zeitlos sind oder nur geringfügige Aktualisierungen benötigen, reduziert sich der spätere Aufwand erheblich
- Eine Produktion lohnt sich ab etwa 100 Nutzungen – Das kann z.B. bedeuten:
- 100 Personen, wenn das E-Training mindestens 1-mal eingesetzt wird (z.B. in einem Semester)
- 50 Personen, wenn das E-Training mindestens 2-mal eingesetzt wird (z.B. in zwei Studien- ODER Jahrgängen)
- 25 Personen, wenn das E-Training mindestens 4-mal eingesetzt wird (z.B. in zwei Studien- UND Jahrgängen)
3. Wie viel meiner Lehrveranstaltung sollte ich als E-Training bereitstellen?
Empfehlung der FHV zum Produktionsaufwand
Zunächst ist eine Unterscheidung erforderlich: Laut der FHV-Strategie zum Blended Learning sollen in einer BL-Lehrveranstaltung 30 Prozent der Lehreinheiten (LE) asynchron gestaltet werden. Theoretisch könnten diese 30 Prozent vollständig durch E-Trainings abgedeckt werden. Praktisch empfiehlt sich jedoch ein ausgewogener Mix verschiedener Lernformen im asynchronen Raum.
Insbesondere wenn ein E-Training erstmals in einer Lehrveranstaltung eingesetzt wird, empfehlen wir, den Anteil der Lehreinheiten (LE), die durch E-Trainings abgedeckt werden, auf maximal 10 Prozent zu begrenzen. So wird sichergestellt, dass der Arbeitsaufwand – einschließlich Vor- und Nachbereitungszeiten – im verfügbaren Rahmen bleibt.
Beispiele für die Planung:
- Kurs mit 15 LE: max. 1,5 LE E-Training → ca. 70 Minuten
Ratsam: Zwei kleinere E-Trainings à 35 Minuten statt eines großen Moduls - Kurs mit 30 LE: max. 3 LE E-Training → ca. 135 Minuten
Ratsam: Fünf E-Trainings à 27 Minuten statt eines großen Moduls
Unterscheidung Lehr- und Lernzeit
Die Lehreinheiten (LE) eines E-Trainings entsprechen grundsätzlich der Zeit, die ihr in einem Seminar oder einer Vorlesung für die Vermittlung eurer Inhalte einsetzt. Im E-Training verschwimmt jedoch oft die Grenze zwischen direkter Lehrzeit und der Zeit, die Studierende zusätzlich für selbstständiges Lernen im Rahmen der ECTS aufwenden – zum Beispiel für das Lesen von Literatur, das Anschauen längerer Videos oder das Bearbeiten von Aufgaben. Diese Zeit wird noch dazu gerechnet – mehr dazu findet ihr im nächsten Punkt 4.
Warum kleinere Einheiten sinnvoll sind:
- Bessere Performance: Bei zu langen E-Trainings kann z.B. Rise360 langsamer werden oder der Upload im ILIAS sehr lang dauern. Details dazu findet ihr in den FAQs zu Rise360 unter Punkt 5.
- Gestaffelter Arbeitsaufwand: Ihr könnt die Produktion über mehrere Semester verteilen. Beispiel: Im ersten Semester entwickelt ihr ein erstes E-Training, im nächsten Semester folgt ein weiteres. So bleibt der Arbeitsaufwand überschaubar und die spätere Wartung auch.
4. Wie viel Zeit sollten die Studierenden für die Bearbeitung eines E-Trainings brauchen?
Was fließt in die Bearbeitungszeit?
Wie bereits in Punkt 3 erwähnt, verlaufen die Grenzen zwischen Lehrzeit – also den vorgesehenen Lehreinheiten (LE) – und der individuellen Vertiefungszeit der Studierenden im E-Training oft fließend. Wichtig ist: Ein E-Training bedeutet mehr, als nur Inhalte zu konsumieren. Studierende sollen sich aktiv mit dem Material auseinandersetzen.
Damit wird klar: Zur eigentlichen Lehrzeit kommen immer zusätzliche Selbstlernzeiten hinzu, die zusammen die gesamte Bearbeitungszeit ergeben. Grundlage für diese Planung ist die ECTS-Zeit. Überlegt euch also genau, welchen Anteil davon ihr für das E-Training vorseht.
Beispiele zur Orientierung:
Bei unserem E-Training mit 1,5 LE:
- ca. 70 Minuten sind Inhaltsvermittlung im E-Training
- ca. 80 Minuten hat die Lehrperson für die vertiefenden Aufgaben vorgesehen
---------------------------
= zusammen sind das 2,5 h Bearbeitungzeit (entspricht der ECTS-Zeit)
= zusammen sind das 2,5 h Bearbeitungzeit (entspricht der ECTS-Zeit)
Was können begleitende Aufgaben sein:
- Lesen von z.B. wissenschaftliche Artikel, Buchkapitel oder Berichte auf Webseiten
- Anschauen oder hören von z.B. Interviews, Dokumentationen oder wissenschaftliche Podcasts
- Recherchieren zu einem Thema etc.
- Verfassen von z.B. Reflexionen, einem Lernportfolio oder Forumsbeiträgen
- Absolvieren von Wissensüberprüfungen oder Aufgabenstellungen
- ...
- ...
Nicht alle Selbstlernaufgaben müssen im E-Training abgebildet sein
Der asynchrone Lernraum soll vor allem Selbstverantwortung und eigenständiges Lernen fördern. Deshalb müssen nicht alle Inhalte interaktiv im E-Training aufbereitet sein. Studierende dürfen auch durch ergänzende Materialien in ILIAS oder andere Aufgaben zur Selbstbearbeitung gefordert werden. Wichtig ist, die Verteilung von Lehr- und Selbstlernzeiten bewusst zu gestalten.
5. Wie viel Zeit sollte ich für die Erstellung eines E-Trainings einplanen?
Arbeitsschritte & Zeitaufwand für ein E-Training mit einer LE (45 min.)
Inhaltliche Strukturierung & Konzeption
2–3 Stunden
Umsetzung im Tool (inkl. Medien, Links, PDFs)
3–4 Stunden
Quiz-Erstellung & Integration
1–2 Stunden
Testen, Korrekturen, Feinschliff
1–2 Stunden
Gesamter Aufwand
≈ 7–10 Stunden
(Ø 1,5 Arbeitstag)
(Ø 1,5 Arbeitstag)
6. Wann kann sich der Zeitaufwand weiter erhöhen?
Einflussfaktoren auf den Zeitaufwand:
- Komplexität der Inhalte: Je höher der fachliche Erklärungsbedarf oder je interaktiver die Elemente, desto größer der Aufwand – dieser kann 12 Stunden und mehr betragen.
- Routine-Effekte: Zu Beginn braucht es Zeit, um sich mit dem Programm und der neuen Art der Aufbereitung vertraut zu machen. Das kann anfänglich zu doppelter Bearbeitung führen. Mit wachsender Erfahrung und durch die Wiederverwendbarkeit von Materialien sinkt der Aufwand jedoch deutlich.
- Mediale Aufbereitung: Wenn passende Medien-Quellen (z. B. Videos, Podcasts, Links) erst recherchiert und ausgewählt werden müssen, erhöht sich der Aufwand für Strukturierung und Konzeption.
- Neuentwicklung von Lehrinhalten: Wenn die Inhalte einer Lehrveranstaltung noch neu erstellt werden müssen, steigt der Zeitaufwand erheblich. Die reine Konzeption einer neuen LV ist in den genannten Beispielen nicht berücksichtigt.
Inhalt
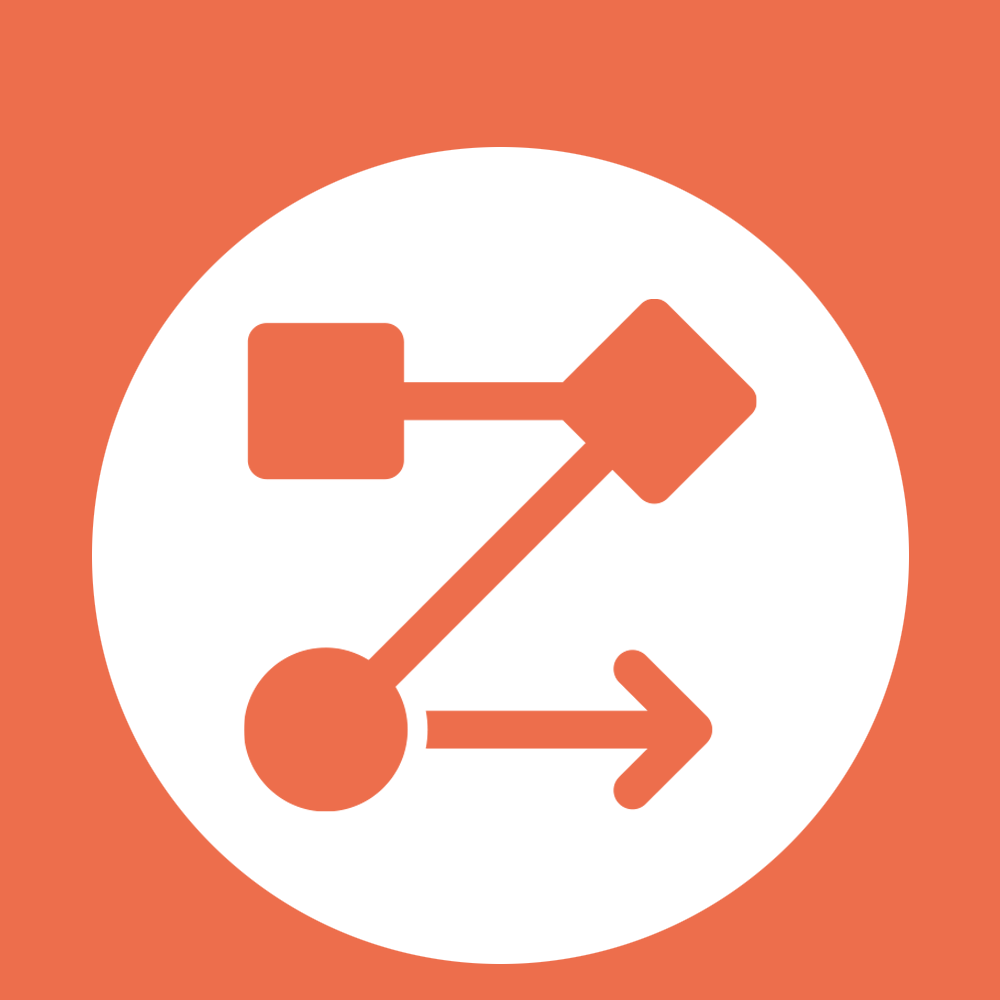
Schritt für Schritt erklären wir euch, wie ihr Rise360 kennenlernen könnt, wie ihr startet und eine Lizenz beantragt

In diesem Formular erfassen wir Rahmendaten und zusätzlichen Fragen unterstützen euch bei der Projektskizze